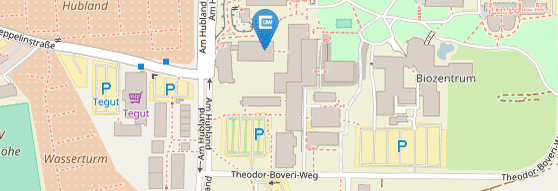Naturwissenschaften studieren - aber wie?
Hier finden Sie nichts über Studienpläne, Lehrbücher usw. – dafür aber manches, was Ihnen Ihren Weg deutlicher erkennen lässt. Bevor Sie einsteigen, sollten Sie jedoch besser die folgende Frage prüfen:
Bin ich auf dem richtigen Dampfer?
Zum Studium der Naturwissenschaften braucht man keine speziellen Begabungen wie etwa für Mathematik und Musik. Gebraucht wird ein waches Interesse für alle kleinen und großen Phänomene, die einem begegnen, und die Fähigkeit, das „so sein“ nicht für selbstverständlich zu halten, sondern sich darüber zu wundern: Vielleicht könnte es auch ganz anders sein? So kann sich eine dauernde Fragehaltung entwickeln. „Wieso?“ „In welchem Zusammenhang?“ Das gilt auch für den Stoff von Vorlesungen, Praktika, Seminaren, Lehrbüchern und Originalliteratur. Nicht jede Frage lässt sich durch eigene Kraft oder mit fremder Hilfe sogleich beantworten, und manche Antworten erzeugen neue Fragen. Wichtig ist, bestimmte Fragen in sich zu bewegen, dann kommt die Antwort bisweilen ganz unverhofft, wenngleich manchmal erst nach Jahren.
Kurz – gefragt ist die Haltung des Archimedes: Er freute sich nicht nur über sein Leichtgewicht beim Baden, sondern wunderte sich darüber und fragte sich: „Wieso eigentlich?“ Wir alle kennen seine Freudensprünge, als er die Antwort gefunden hatte. Diese betraf nicht nur ihn, sondern war ein allgemeines Gesetz, das sogar aussagt, um wie viel dein Körper im Wasser leichter wird! Das wird seine Freude am Baden noch vergrößert haben.
Wem diese Haltung fremd ist oder nur mit Mühe zu verwirklichen, den wird das Studium einer experimentellen Fachrichtung nur wenig befriedigen. Konsequenterweise bleiben dann auch Erfolgserlebnisse aus. Das ist ein Signal, sich frühzeitig einer Ausbildung zuzuwenden, bei der diese Fragehaltung nicht gefordert wird. Das trifft auch für alle zu, denen es Mühe macht, während des Semesters wenigstens drei Abende der Woche dem Studium zu widmen, und denen ein Wochenende von Freitag bis Montag unverzichtbar erscheint.
Die Frage nach dem Wie.
Am Arbeitsstil hängt der Erfolg! Nach meinen langjährigen Erfahrungen bringen die beiden folgenden, sich ergänzenden Empfehlungen den besten Nutzen:
Das große Ziel: Gelegenheitsarbeiter!
Nutzen Sie die eben gehörte Vorlesung, den gerade durchgeführten Versuch, die Themen des letzten Seminars usw. sogleich zum Erarbeiten des Stoffes, vor allem aber versuchen Sie, die jeweiligen Zusammenhänge zu finden, dann wird sich das scheinbare Chaos von Einzelfakten in eine wunderbar geordnete, reiche Vielfalt verwandeln. Fragen Sie Unverstandenes Ihre Mitstudenten, Assistenten oder Professoren! Allerdings sollte man diese nicht als bequemes Lexikon benutzen, sondern erst selbst nachdenken. Gelingt die volle Aufklärung nicht, dann hilft eine Notiz „Problem X klären!“ für die spätere Bearbeitung.
Nach dem Rezept „jetzt kochen, später lernen“ lässt sich der jeweilige Stoff viel schwieriger dauerhaft und schöpferisch verankern, da die direkte Stütze der „Handarbeit“ fehlt.
Genauso gilt aber auch: Zwischen den Semestern sollten Sie für drei bis vier Wochen alles vergessen! Diese Zeit der unbewussten Klärung hilft viel, um dann mit frischen Kräften den Stoff aufarbeiten zu können. Dazu gehört nicht nur Lesen, sondern auch Schreiben und Zeichnen (z.B. chemische Stereoformeln), und zwar mit der Hand! Dieser altmodische Vorschlag hat einen physiologischen Grund: Was über die eigene Hand geht, eignet man sich dauerhafter an als nur Gelesenes oder am Bildschirm Erzeugtes. Dazu kommt, dass die Medientechnik (Fotokopieren) kaum mehr zum prägnanten eigenen Formulieren zwingt. Gerade diese Fähigkeit ist aber unabdingbar beim Erfassen eigener und fremder Forschungsergebnisse.
Als ich das Studium begann (1939) und auch später noch (bis etwa 1965) gab es keinerlei Fotokopien, Handouts, Vorlesungsmanuskripte usw. Vom ersten Tag an war ich gezwungen, Gehörtes in Kurzformulierungen festzuhalten. Literatur und Vorschriften konnte ich nur in der Bibliothek lesen und musste dabei lernen, das jeweils Wesentliche zu erfassen und zu formulieren. Bei der heutigen Stoff‐Fülle ist das nicht mehr möglich, so dass dieses zwangsläufige Training entfällt und daher bewusst ergriffen werden muss.
Gut geplant ist halb gewonnen.
Ein persönliches Erlebnis mag dies erläutern: In den chemischen Praktika hatte ich als Nebenmann einen zehn Jahre älteren Laboranten, der auf dem zweiten Bildungsweg Chemie studierte. Stets liefen bei ihm gleichzeitig zwei Versuche, die er am Abend zuvor sorgfältig geplant hatte (Welches Problem umfasst der Versuch? Zeiteinteilung? Geräte? besondere Apparaturen? Chemikalien?). Die Apparaturen wurden rasch und zielsicher aufgebaut, jedes Reagenz stand da, wo es gebraucht wurde. Überflüssiges wurde sofort weggeräumt und der Reaktionsverlauf sorgfältig beobachtet. Der Labortisch sah aus wie geleckt und die Ergebnisse waren meist viel besser als meine. Ich habe viel von ihm gelernt.
Hier wurde mir vor Augen geführt, dass Chemiestudenten nicht nur eine Wissenschaft studiert, sondern auch ein Kunsthandwerk erlernen, dessen Beherrschung große Befriedigung bereitet.
Später hat mir meine Erfahrung immer wieder gezeigt: Gute Planer sind auch rasche und gute Arbeiter und deshalb Leute mit echter Freizeit für Hobbies usw. Wenn Sie wissen wollen, wie es bei Ihnen damit steht, blicken Sie auf Ihren Schreibtisch und Ihren Laborplatz.
Ich denke, die besprochenen Vorschläge können Ihnen helfen, Ihr Studium mit mehr Freude anzupacken und allmählich eine Selbstsicherheit zu gewinnen, die Ihnen sagt, wo Sie stehen. Dann können Sie mit Wilhelm Busch sagen:
Früher, als ich unerfahren
und bescheidner war als heute,
hatten meine höchste Achtung andre Leute.
Später traf ich auf der Weide
außer mir noch andre Kälber,
und nun schätz ich sozusagen
erst mich selber.
Nach diesen Vorschlägen zur Beherrschung der täglichen Arbeit eines jeden experimentellen Faches wird es Zeit, dass wir zur Sache selber kommen. Und da lohnt es sich, tief zu bohren.
Die Frage nach dem Was.
Was heißt naturwissenschaftliches Denken und Handeln?
Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise oder deren Ergebnisse durchdringen heute unser tägliches Leben bis in den letzten Winkel. Dabei bemerken wir gar nicht mehr, dass es sich um eine spezifische Betrachtungsweise handelt, die erst vor ca. 500 Jahren (Kepler, Galilei) entstanden ist und sich seit dem 17.Jahrhundert (Descartes, Newton) stürmisch entwickelt hat.
Wenn man sich aktiv in diesen Prozess einschalten will, tut man gut daran, sich zu besinnen, wie unser tägliches „Weltbild“ entsteht.
Außen und Innen.
Unsere Sinne machen uns die Außenwelt zugänglich über die Wahrnehmung (Farben, Formen, Töne, Gerüche usw.), die wir durch das Denken über Vorstellungen und Begriffe in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und einer Bewertung unterziehen. Psychische Gesundheit ist an das effektive und unbemerkte Ineinandergreifen dieser beiden Pole gebunden. Dass wir Begriffe nicht an der Außenwelt ablesen, sondern in uns erzeugen, sei an zwei Beispielen erläutert:
1. Als Kleinkind haben wir durch mühsames Probieren gelernt, was eine „Stufe“ ist. Jetzt, als Geologiestudent, lernen wir in bestimmten Tälern ein „Stufenprofil“ kennen und die Oberflächenschichten eines unter dem Mikroskop betrachteten Kristalls beschreiben wir als „in Stufen angeordnet“. Jeder versteht sofort, was gemeint ist, obwohl die beiden Dimensionen von der Treppenstufe meilenweit entfernt sind. Offenbar haben wir die bedeutungsneutrale Wahrnehmung bestimmter abrupter Höhenunterschiede mit dem Begriff „Stufe“ belegt, der damit an keine äußere Dimension gebunden ist.
2. Welche Konsequenzen dieses Verhältnis von Wahrnehmung und Begriff haben
kann, sehen wir an folgendem Beispiel:

Was sehen Sie? „Na klar, ein Bild mit Büchern!“ Aber schauen wir lieber nach!
Das herausgezogene Buch war also eine Attrappe, und ich bedaure, die virtuellen Gummibärchen nicht verteilen zu können. Was ist geschehen?
Aus unserer Erfahrung heraus belegen wir die Wahrnehmung eines Gegenstandes bestimmter Größe mit Flächen, Kanten, der Schnittfläche der Seiten und mit einem Aufdruck mit dem Begriff „Buch“. Hier haben wir uns also zu einem Vorurteil, d.h. einem Fehlurteil, verleiten lassen, weil wir die (unvollständige) Wahrnehmung sogleich mit einem Begriff verbunden haben. Genau dieses Phänomen nutzt jede gute Zaubervorstellung aus. (Vorurteile sind der Todfeind wissenschaftlichen Arbeitens, denn sie werden ja nicht als solche erkannt, sodass sie nicht, wie der Irrtum, zur Korrektur aufrufen).
Naturwissenschaften betreiben heißt also, die Wahrnehmung zur genauen Beobachtung zu steigern und bewusst und streng vom Denken (Schlussfolgerung) zu trennen. Unter diesen Kriterien hat eine hundert Jahre alte Beschreibung einer Beobachtung oder eines Versuches noch heute Gültigkeit, auch wenn wir diese in einem anderen theoretischen Zusammenhang sehen.
Die Erwerbung dieser Fähigkeit ist das wahre Studienziel jedes experimentellen Faches. So betrachtet, liefert Ihnen Ihr Studiengang das Material für Ihr persönliches Training von Beobachten und Denken. Diese schließlich erworbene Fähigkeit erlaubt eine stete Weiterbildung und eine fachübergreifende Tätigkeit, die in Zukunft immer wichtiger werden wird. Denn gefragt ist nicht mehr der enge Fachspezialist sondern der Problemspezialist, der die Ergebnisse verschiedener Fächer verwerten kann.
Das Super‐Training: Experimentieren plus Protokollieren.
Dies ist der einfachste Weg, eine naturwissenschaftliche Denk‐ und Arbeitsweise zu erlernen. Jedes Experiment wird mit einer bestimmten Zielsetzung begonnen, und man muss zunächst prüfen, ob die Voraussetzungen (Anfangsbedingungen) und der beabsichtigte Verlauf überhaupt die gewünschte Aussage zulassen. Läuft aber das Experiment, so muss man das Ziel völlig vergessen und sich voll darauf konzentrieren, was tatsächlich passiert und nicht, was (z.B. nach einer Laborvorschrift) passieren soll.
Das beste Training hierfür ist das Versuchsprotokoll. Testen Sie sich selbst mit dem folgenden Versuch, der die Charakteristika auch komplexer Experimente besitzt:
Ausgangssituation – Ablauf – Endsituation.
Sehen Sie sich den Versuch zweimal an und schreiben Sie ein Protokoll, bevor Sie weiterlesen.
Jetzt biete ich Ihnen zwei Versuchsprotokolle an:
Protokoll 1: „Die Röhre wurde senkrecht gehalten, der weiße Ball von unten eingeführt und die Röhre um 180 Grad gedreht. Der Ball durchlief die Röhre, sodass er am jetzigen unteren Ende entnommen werden konnte. Der Versuch ließ sich mehrmals wiederholen.“
Dieses Protokoll ist ein typischer Fall unzulässiger Vermischung von Beobachtung und Schlussfolgerung, denn was in der „black box“ geschah, entzog sich – wie bei vielen Experimenten – der unmittelbaren Beobachtung.
Protokoll 2: „Die Röhre wurde senkrecht gestellt, der weiße Ball von unten eingeführt, die Röhre um 180 Grad gedreht und unten ein weißer Ball entnommen. Der Versuch ließ sich mehrfach wiederholen.
Schlussfolgerung: Die Anordnung erlaubt nicht festzustellen, ob der eingeführte Ball mit dem entnommenen identisch ist. Um das zu entscheiden, müsste der Ball markiert werden (Vergl. Isotopen‐Versuche !).
Neuer Versuch (Protokoll 2a): „Der weiße Ball wird durch einen blauen ersetzt.
Ergebnis:
An Stelle des eingeführten blauen Balles tritt ein weißer zutage. Schlussfolgerung:
Eingeführter und entnommener Ball sind nicht identisch. Wahrscheinlich ist die
Röhre mit weißen Bällen gefüllt.“
Protokoll 2 gibt also den beobachtbaren Sachverhalt korrekt wieder, regt aber zu einem
weiteren Versuch an, der nach Protokoll 2a eine viel interessantere Erkenntnis liefert.
Einige lehrreiche Beispiele aus der Chemie
Wie wichtig es ist, Zielvorgaben (Denken), Versuchsverlauf (Beobachtung) und Schlussfolgerungen (Denken) streng auseinander zu halten, belegen die folgenden Beispiele:
1. In einer großen Versuchsserie hatten wir zwei Edukte zu den gewünschten Produkten umgesetzt. Aber wir hatten nicht bedacht, dass die Reaktion über ein Intermediat laufen könnte (black box!). Von anderer Seite wurde später gezeigt, dass sich dieses Intermediat bei geänderter Versuchsführung fassen lässt.
2. Um die Gültigkeit eines Strukturprinzips für bestimmte Redoxsysteme zu prüfen, sollte auf bisher nicht erprobtem, aber plausiblem Wege eine bestimmte Substanz hergestellt werden. Die Umsetzung verlief ziemlich glatt, aber an Stelle der gewünschten Verbindung war eine andere entstanden. Nach einigem Zögern wurde das ursprüngliche Ziel verlassen und die Struktur dieser Substanz aufgeklärt: Es hatte eine unerwartete Reaktion zu einem bisher unbekannten Strukturtyp stattgefunden, die ein neues Arbeitsgebiet eröffnete.
Zahlreiche „Zufallsentdeckungen“ in der Literatur gründen auf sorgfältiger Beobachtung und Offenheit für das Unerwartete, wie die folgenden Beispiele zeigen:
3. Der nordamerikanische Chemiker Ch. Goodyear (1800 – 1860) interessierte sich für den damals wenig beachteten Naturkautschuk, dessen chemische Struktur unbekannt war.
Beim Abkühlen wurde er hart, beim Erwärmen aber klebrig, weich und plastisch. Goodyear versuchte durch Verkneten mit Schwefel bessere Eigenschaften zu erzielen, jedoch ohne Erfolg.
In einem der Reihenversuche zeigten sich unerwartet neue Eigenschaften: Es war ein unlösliches, unschmelzbares, elastisches Material entstanden. Sorgfältige Beobachtung ergab, dass diese Probe zu nahe an einen heißen Ofen geraten war. Die hohe Temperatur hatte die Verwandlung bewirkt. Goodyear hatte die Vulkanisation des Kautschuks entdeckt, die noch heute Grundlage für die Herstellung der verschiedensten Gummisorten aus natürlichem und künstlichem Kautschuk darstellt.
4. K. Ziegler (1898 – 1973, Nobelpreis 1963) experimentierte u.a. mit hoch luft‐ und feuchtigkeitsempfindlichen Aluminium‐Alkylen. Er fand heraus, dass die Alkylketten durch Einlagern von Ethylen (Ethern) unter Druck und Erwärmen um 1 bis 10 CH2CH2‐Einheiten verlängert werden können. Eines Tages verlief ein solcher Versuch völlig anders. Das Ethylen wurde weitgehend verbraucht, und beim Öffnen des Autoklaven fand sich eine paraffinartige Masse – ein Polyethylen. Das war ein unglaublicher Befund, denn bis dahin hatten zahllose Versuche gezeigt, dass Ethylen nur unter extrem hohen Druck polymerisierbar war.
Eine intensive Nachforschung ergab, dass dieser Versuch, der genau wie alle anderen angesetzt worden war, in einem Punkte abwich: In dem Autoklaven war vorher mit einem Nickelkatalysator hydriert worden, von dem sich noch Spuren nachweisen ließen. Dieser „Ausreißer“ veranlasste Ziegler, zahlreiche Metallsalze (die von Aluminiumalkyl reduziert wurden) als Zusatz zu prüfen. Damit wurde das Unglaubliche wahr: Ethylen ließ sich durch Zusatz von Titanverbindungen drucklos polymerisieren. Ein völlig neues Gebiet der Kunststoffchemie war eröffnet.
Wie gestalte ich ein Experiment?
Aus dem Besprochenen ergibt sich eine klare Abfolge:
1. Fragestellung (= Denkschritt)
2. Ausgangssituation
3. Ablauf des Vorgangs (= Beobachtungsschritte)
4. Endsituation
5. Schlussfolgerung (= Denkschritt)
Die wissenschaftliche Erkenntnis gewinnt man aus der Abfolge 3. bis 5.
Dieser Arbeitsstil kann nicht früh genug geübt werden. Deshalb sind die Versuche in dem „Integrierten Organisch‐Chemischen Praktikum“ (Hünig, Märkl, Sauer 1979), das umgestaltet wurde zum Organisch‐chemischen Praktikum im Internet (ab 2002), wie folgt gegliedert:
1. Allgemeine Problemstellung (Einführung)
2. Ansatz
3. Durchführung der Reaktion
4. Aufarbeitung (Isolierung und Reinigung)
5. Analytik, Identitätsnachweis
6. Schlussfolgerungen (siehe Protokoll)
Diese Gliederung empfiehlt sich auch für die Protokollführung. Da diese ein hervorragendes Mittel zur Schulung von Beobachtung und Denken und Erziehung zur nüchternen Ehrlichkeit darstellt, ist sie am Arbeitsplatz unerlässlich, und zwar in einem gebundenen Heft ohne jede Zettelwirtschaft. Nicht, was sein sollte, sondern was tatsächlich getan und beobachtet wurde, ist hier gefragt, und zwar mit allen „Unglücken“ (z.B. zu rascher oder zu langsamer Zugabe eines Reagens, kurzzeitig erhöhten Temperaturen usw.). Gedanken dazu können jeweils in Klammern dazugefügt werden. Ein Resümee am Schluss fasst das Ergebnis zusammen, aus dem man ableiten kann, ob und wie eine Verbesserung oder Lenkung in eine andere Richtung möglich erscheint bzw. welche Zusatzexperimente zur weiteren Klärung der Situation nötig sind.
Wohin führt der Weg zu guter Letzt? Wer sich durch eigenes Training während des Studiums die hier beschriebene Haltung zu eigen macht, wird auch bei der Bearbeitung eng begrenzter Fakten ein Gefühl für das weite Feld naturwissenschaftlicher Forschung und Welterschließung gewinnen. Aber gerade deshalb ist die Warnung des Göttinger Physikers Chr. Lichtenberg ( 1742 – 1799) ernst zu nehmen:
Wer nur Chemie versteht,
versteht auch von der nichts.
Gemeint ist, dass diese objektivierende Wissenschaft sich bewusst vom Subjekt löst. Das heißt aber, dass die lebenswichtigen Fragen für das Subjekt, also für jeden Einzelnen von uns (wie z.B. Kunst, Philosophie, Religion und Moral, Verantwortung, Sinnhaftigkeit) mit Methoden entwickelt werden müssen, in die das Subjekt bewusst einbezogen ist, und die daher aus anderen Quellen schöpfen müssen. Wer sich auch diese Quellen lebenslang erschließt, wird die wahre Bedeutung der Naturwissenschaften immer deutlicher erkennen.
Viel Freude am Studium!
Wie es zu diesem Text kam
Im Wintersemester 1991 hielt ich zum letzten Male einen Vortrag für Studenten aller experimentellen Naturwissenschaften, wie ich ihn zuvor alle zwei Jahre über mehr als zwei Jahrzehnte angeboten hatte.
Es ging darum, unabhängig von Studienplänen, Lehrbüchern und (elektronischen) Hilfsmitteln die Grundprinzipien naturwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens aufzuzeigen und damit auch die Grundvoraussetzungen und Grundanforderungen für ein sinnvolles und im persönlichen Sinne befriedigendes Studium.
In den letzten Jahren wurde ich mehrfach auf den positiven Effekt dieser Darstellungen angesprochen. Ich wage es daher, die damaligen kurzen Notizen zu dem vorliegenden Text zu verarbeiten. Trotz des gravierenden Wandels der äußeren Bedingungen und teilweise auch der Studienziele hoffe ich, dass Orientierung suchende Studenten hier einige Hilfen finden, gerade auch für das immer wichtiger werdende fachübergreifende Denken und Handeln.
Ich hoffe zugleich, Impulse zu geben, Vorlesungen, Praktika und Seminare als Trainingsmöglichkeiten für ein aktives Studium aufzufassen und nicht als unvermeidliche Voraussetzungen für Prüfungen.
Um sich den Vortragscharakter besser vorstellen zu können, sei darauf hingewiesen, dass alle Kernpunkte und Schemata an der Tafel entwickelt wurden, unterstützt von einigen „Experimenten“.
S. Hünig, Würzburg, April 2006